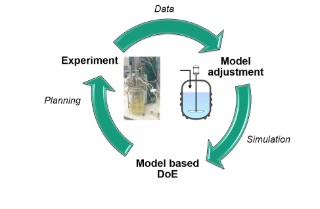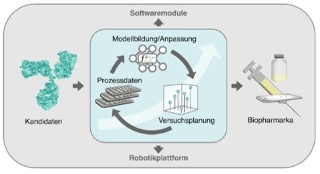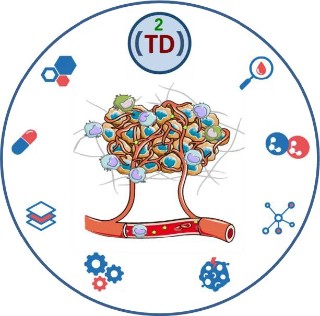In dieser Übersicht finden Sie Informationen über unsere Forschungsprojekte, die wir gemeinsam mit Partner aus der Industrie und Wissenschaft durchführen.
Förderung erhalten wir beispielsweise von öffentlichen Fördergebern wie der Europäischen Union, von verschiedenen Bundesministerien wie BMFTR (ehemals BMBF), BMLEH (ehemals BMEL), BMWE (ehemals BMWK) und BfN sowie von den Landesministerien in Nordrhein-Westfalen wie dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie (MWIDE) und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW). Auch Projekte, die durch Stiftungen finanziert oder innerhalb interner Programme der Fraunhofer-Gesellschaft sowie im Rahmen von Industriekooperationen von uns bearbeitet werden, können Sie hier finden.
Für die Suche können Sie beliebige Suchbegriffe wählen und den Suchzeitraum auf die Laufzeit der Projekte eingrenzen. Gerne lassen Ihnen unsere jeweiligen Ansprechpartner zu den Projekten weitere Informationen zukommen.
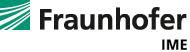 Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME
Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME