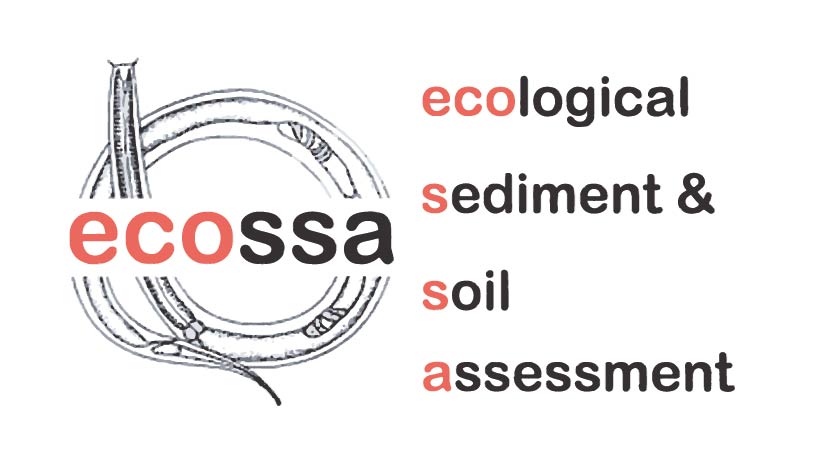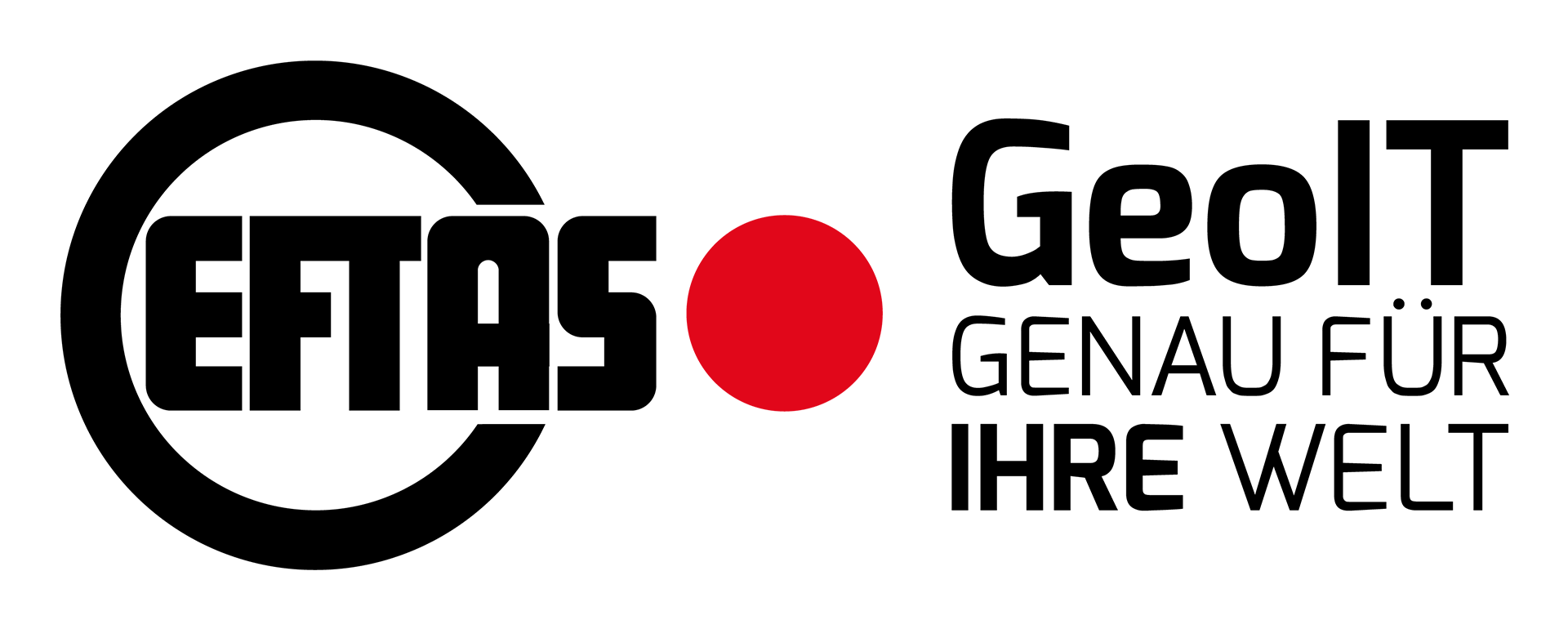Bisher blieb die Welt der Bodenorganismen oft verborgen, obwohl sie für den Menschen essentiell ist. Der Wert der Bodenbiodiversität wurde lange unterschätzt, obgleich sie überhaupt erst das Funktionieren unserer Ökosysteme sicherstellt.
Ist der Boden gesund, sind Bodentiere und Mikroorganismen aktiv. Sie steuern Nährstoffkreisläufe, speichern Kohlenstoff in Böden, durchmischen die Bodenschichten und helfen dabei, Regenwasser zu speichern. Hier sind ‚Ökosystemingenieure‘ wie zum Beispiel Regenwürmer am Werk. Aber auch Insekten, die wir sonst oberhalb der Böden wahrnehmen, sind auf gesunde Böden angewiesen. So nistet ein Großteil der für die Bestäubung wichtigen Wildbienenarten in Böden.
Doch zahlreiche schädliche Einwirkungen wie Bodenbelastungen, nicht nachhaltige Bodennutzung und der Klimawandel setzen der Bodenbiodiversität zu. Um die Folgen besser verstehen und ihnen entgegenwirken zu können, wird in dem Forschungsprojekt nun die typische Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften in den Böden Deutschlands erforscht. Ziel der ‚Basiserfassung Bodenbiodiversität‘ – kurz: BioDive4Soil, die im Rahmen des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz (ANK) umgesetzt wird, ist es, den guten biologischen Bodenzustand zu definieren und folgenreiche Abweichungen zu erkennen. Zusammen mit der Erhebung von Daten zu Regenwürmern, Springschwänzen, Milben, Nematoden, Pilzen und Bakterien werden auch Einflussfaktoren erfasst. Denn im Gegensatz zu den umfangreichen Kenntnissen z. B. über Gewässerökosysteme, fehlen Informationen zur Bewertung des biologischen Bodenzustands und seinen Veränderungen über die Zeit bisher gänzlich.

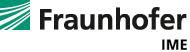 Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME
Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME