Nach erfolgter Neuorganisation von zentralen wie institutsinternen Prozessen war 2024 das Jahr der Implementierung und Etablierung. Der Strategiereport für den Zeitraum 2024 bis 2028 wurde erstellt und auditiert. Für das Gesamtinstitut und für die Bereiche Molekularbiologie, Bioressourcen und Angewandte Oekologie enthält er eine Positionsbestimmung und Entwicklungsziele zu den Strategieperspektiven Finanzen, Personal, Forschung sowie Kunden und Markt. Die Empfehlungen der Auditoren fließen in die Entwicklung von Maßnahmenbündeln zur Erreichung der Strategieziele ein. »Agrinomics« wurde von allen Auditoren als Möglichkeit für ein zukunftsweisendes Themen- und Methodenportal und identitätsstiftendes Alleinstellungsmerkmal gesehen, welches institutsweit entwickelt werden sollte. Ein entsprechender Kickoff-Workshop fand mit allen Abteilungs- und Gruppenleitenden im März 2025 statt.
Vorwort

Am Standort Aachen und Münster wurde sowohl 2024 als auch 2025 der Fokus auf die Bioökonomie gelegt. Dies wird anhand neuer Projekte verdeutlicht, die innovative Lösungen für Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion und Industrie bieten. Von großer Bedeutung für den Standort Aachen ist das vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft geförderte Forschungsprojekt »FishPlant«, in dem das Fraunhofer IME gemeinsam mit einem Aachener Nahrungsmittelerzeuger ein nachhaltiges Kreislaufsystem entwickelt, das die duale Produktion von Salzwasserfischen mit Meeresgemüse wie Seespargel ermöglicht. Für die Produktion des Seespargels setzen wir unser patentiertes Vertical Farming-System OrbiLoop® ein, das ebenfalls im Verbundprojekt »Mittendrin« eine zentrale Rolle spielt. Hier wird u.a. gemeinsam mit der Stadt Aachen im Rahmen einer Machbarkeitsstudio die Integration von Vertical Farming-Technologien in die Stadtarchitektur untersucht. Das Projekt »MagnI-SENSE« entwickelt Analyse- und Monitoringsysteme, um Landwirten die Detektion von Pflanzenkrankheiten im Feld zu ermöglichen. Im Projekt »ReCO2NWert« verfolgen wir in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen University und dem Rheinischen Revier das Ziel, durch biotechnologische CO2-Nutzung die Ressourcenwende in der chemischen Industrie voranzutreiben.
Am Standort Münster konnte das Projekt zur Entwicklung des Russischen Löwenzahns als alternative Quelle für Naturkautschuk erfolgreich fortgeführt werden. Darüber hinaus wurden im Rahmen der BMBF-Ausschreibung »Moderne Züchtungsforschung für klima- und standortangepasste Nutzpflanzen von morgen« in Kooperation mit der Universität Münster sowie weiteren Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft neue Projekte mit den Schwerpunkten Kartoffel und Buchweizen eingeworben. Ein aktuelles, vom BMEL/FNR gefördertes Vorhaben mit dem Titel »INSOLNET« erweitert die Forschungsaktivitäten im Bereich der funktionellen und angewandten Genomforschung an der Kartoffel und untersucht die Rolle eines neu entdeckten Wirkstoffs bei der Entwicklung wirksamer Resistenzen gegenüber wirtschaftlich relevanten Pathogenen. Darüber hinaus konnten auf Basis des PREPARE-Vorhabens »SEEDPLUS« erste neue Projekte zur Nutzung innovativer Saatgutveredelungsstrategien unter Beteiligung von Industriepartnern erfolgreich initiiert werden. Sie verfolgen das Ziel, wirtschaftlich tragfähige und praxisnahe Lösungen zur Steigerung der Etablierungssicherheit und Ertragsleistung unter wechselnden Standortbedingungen zu entwickeln.
In Schmallenberg wurde 2024 aufgrund der nach wie vor nicht abgeschlossenen Bauarbeiten und den Nachwirkungen der Kostensteigerungen von Energie und Personal zwar erneut ein negatives Jahresergebnis erwirtschaftet, doch führen die immer besser nutzbaren Gebäude, Anpassungen der Angebote und Effizienzmaßnahmen in den Abteilungsstrukturen zu sichtbaren Verbesserungen, so dass 2025 mit einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet wird. 2024 wurde die Nachwuchsgruppe Immunökotoxikologie initiiert, die in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen University und der Universität Münster molekulare Auswirkungen von Stoffen auf das Immunsystem von Fischen und Käfern in Labor und Freiland untersuchen wird. Die 2025 bewilligte Attract-Gruppe B-Pol beschäftigt sich mit Anreicherungsprozessen von Polymeren und Polymerprodukten in Böden und Wasserorganismen. Für die regulatorische Praxis sind die Einführung und Anerkennung der vom Fraunhofer IME entwickelten neuen Testrichtlinie OECD 321 (Hyalella Bioconcentration Test) als wirbeltierfreie Ersatzmethode (s. HYBIT) im Rahmen eines Projekts der European Chemicals Agency (ECHA) von Bedeutung, sowie die ebenfalls von der ECHA beauftragte Erarbeitung einer Guidance für den Umgang mit schwer zu testenden Substanzen in Verbleibstudien. Von besonderer Bedeutung für den Bereich Angewandte Oekologie ist das Projekt Basiserhebung Bodenbiodiversität im Auftrag des Umweltbundesamtes, das mit einer Laufzeit von sechs Jahren, einer Gesamtsumme von 21,3 Mio Euro und der Organisation eines Konsortiums aus zehn führenden Institutionen und Arbeitsgruppen aus ganz Deutschland, das neue Maßstäbe für das deutsche Biodiversitätsmonitoring setzen wird.
Wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unseren Partnern und Förderern für ihr Vertrauen, ihre Ideen und ihr Engagement. Nur durch diesen gemeinsamen Einsatz konnten wir unsere ambitionierten Ziele auch in diesem Jahr erreichen.
Mit diesem Jahresbericht laden wir Sie ein, einen Einblick in unsere Arbeit und ausgewählte Projekte des vergangenen Jahres zu gewinnen. Wir freuen uns darauf, auch im kommenden Jahr gemeinsam mit Ihnen Innovationen voranzutreiben.
Prof. Stefan Schillberg
Prof. Christoph Schäfers
Institutsleitung
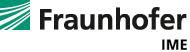 Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME
Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME