Der SeedPlus-Technologie liegen Kernkompetenzen in den folgenden FuE-Feldern zugrunde:
Materialentwicklung und Beschichtungstechnologie
Wir entwickelten Formulierungen für biologisch abbaubare Beschichtungen, die zwei zentrale Funktionen vereinen:
- Optimiertes Wassermanagement - Die Beschichtung reguliert die Wasseraufnahme und -speicherung gezielt und gibt die Feuchtigkeit bedarfsgerecht an das Saatgut ab. Dadurch wird der Samen in der frühen Entwicklungsphase der Kultur bei Trockenstress unterstützt.
- Schutz vor Herbiziden - Eine selektive Barriere bewahrt den Keimling vor schädlichen Herbiziden, ohne die Keimung oder das Wachstum zu beeinträchtigen.
Im Rahmen der Entwicklung von Beschichtungsformulierungen finden ausschließlich natürliche organische und anorganische Materialien Anwendung. Die effizientesten Zusammensetzungen ermitteln wir in systematischen Tests verschiedener Materialkombinationen. Zu den Materialkombinationen zählen Polysaccharide, Proteine, Gummis sowie poröse anorganische Materialien, wie beispielsweise Aktivkohle.
Verkapselungsverfahren, Mantelstruktur und Funktion
Zur Umsetzung der Beschichtung verwenden wir in der SeedPlus-Technologie verschiedene Verfahren, um die Saatgüter mit den ausgewählten Materialien zu verkapseln:
- Trommel-Coater In diesem Verfahren wird das Saatgut in einer rotierenden Trommel bewegt und die Beschichtungsmaterialien schrittweise zugegeben. Dieser Prozess führt zu einer gleichmäßigen Beschichtung des Saatguts und eignet sich für die Massenproduktion.
- Wirbelschichtverfahren Das Saatgut wird durch ein strömendes Gas in der Wirbelschicht gehalten und mit den Beschichtungsmaterialien besprüht. Dieses Verfahren ermöglicht eine präzise Steuerung der Schichtdicke und eignet sich besonders für empfindliche Saatguttypen.
Verträglichkeitstests und funktionale Untersuchungen
Ein weiterer zentraler Bestandteil in SeedPlus ist eine Rückkopplung in den Entwicklungsprozess durch die fortlaufende Evaluation der Funktionalität der entwickelten Formulierungen und Saatgutbeschichtungen. Hierbei wenden wir ein zweistufiges Untersuchungsverfahren an:
- Keimfähigkeit Zunächst wird die Verträglichkeit der verwendeten Rohmaterialien, Formulierungen, der Prozesseinstellungen und der Beschichtungen als Grundvoraussetzung überprüft, um sicherzustellen, dass sie die Keimung nicht beeinträchtigen. Dazu werden Keim- und Triebkraftstests unter kontrollierten Umweltbedingungen durchgeführt.
Bei nachgewiesener Verträglichkeit erfolgt die funktionale Optimierung der Beschichtung mit Bezug auf
- Wassermanagement Ein Hauptanliegen liegt in der Wasserspeicherkapazität der Saatgutbeschichtung durch biologische oder bioabbaubare Materialien. Diese Eigenschaft wird im Zuge des Entwicklungsprozesses sukzessive in standardisierten Trockenstressversuchen im Hochdurchsatz, über anwendungsnahe Gewächshausversuche bis hin zu Freilandversuchen untersucht und verifiziert.
- Schutzwirkung Die Effektivität der Schutzschicht gegenüber Herbiziden oder gegenüber anderen Schadstoffen wird während der Entwicklungsphase ebenfalls in Hochdurchsatzversuchen getestet, und später, unter realen Feldbedingungen überprüfen. Insbesondere wird untersucht, wie gut und lange die Aktivkohle die Herbizide bindet, die Keimung ermöglicht und das Wachstum des Keimlings schützt.
Die Beschichtungsstrategie kann kulturspezifisch optimiert und durch biologische Additive ergänzt werden, um individuelle Anforderungen der Kultur bzw. der Samen zu erfüllen.
Umweltbewertung
Für die neuartigen Saatgutbeschichtungen etablierten wir eine Screening-Plattform zur Bewertung der Umweltverträglichkeit, um bereits während der Materialentwicklung belastbare Aussagen zur Ökotoxizität und zum Abbauverhalten der Beschichtungsmaterialien treffen zu können. Ziel ist es, umweltrelevante Risiken frühzeitig zu identifizieren.
Ökotoxikologie
- Aquatische Ökotoxikologie Im Rahmen des Screeningverfahrens für die aquatischen Untersuchungen wurden nach OECD TG 201, 202 und 236 Grünalgen, Wasserflöhe und Embryos des Zebrabärblings als Modellorganismen herangezogen. Um zeit-, platz- und substanzschonend zu arbeiten, wurden die Testsysteme teilweise miniaturisiert und modifiziert. Somit konnte beispielsweise die OECD TG 236 um Transkriptomanalysen ergänzt werden.
- Terrestrische Ökotoxikologie Die Diversität des terrestrischen Ökosystems wird über Modellorganismen der Mikro-, Meso- und Makrofauna erfasst (OECD TG 216, ISO 15685, ISO 20130, qPCR: archaeale und bakterielle amoA, OECD TG 232, OECD TG 222, ISO 17512-1). Die Ergebnisse zeigen, dass die Bodenmikroorganismen die sensitivste Organismengruppe darstellt, während die anderen untersuchten Organismen weniger empfindlich reagierten.
Abbauverhalten
- Die Untersuchung des Abbauverhaltens erfolgte mit einer standardisierten Screening Methode (OECD TG 301) in wässrigem Klärschlammmedium. Darauf basierend wurde eine modifizierte Screening Methode entwickelt, um in kürzerer Zeit mit weniger Aufwand die potentielle Abbaubarkeit von Polymeren zu bestimmen.
- Ergänzend wird der Abbau der neuen Saatgutbeschichtung in einer Simulationsstudie in Böden (OECD TG 307) getestet. 14C-isotopenmarkierte Polymere in Kombination mit modernen analytischen Verfahren (Pyrolyse-GC/MS, FFF-MALS) ermöglichen eine detaillierte Analyse des Abbauverhaltens.
- Die Übertragbarkeit der Ergebnisse aus der Simulationsstudie wird mit einem Outdoor-Versuch unter realen Umweltbedingungen überprüft. Auch dabei wird die 14C-Isotopenmarkierung genutzt, um den Abbau zu verfolgen.
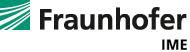 Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME
Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME