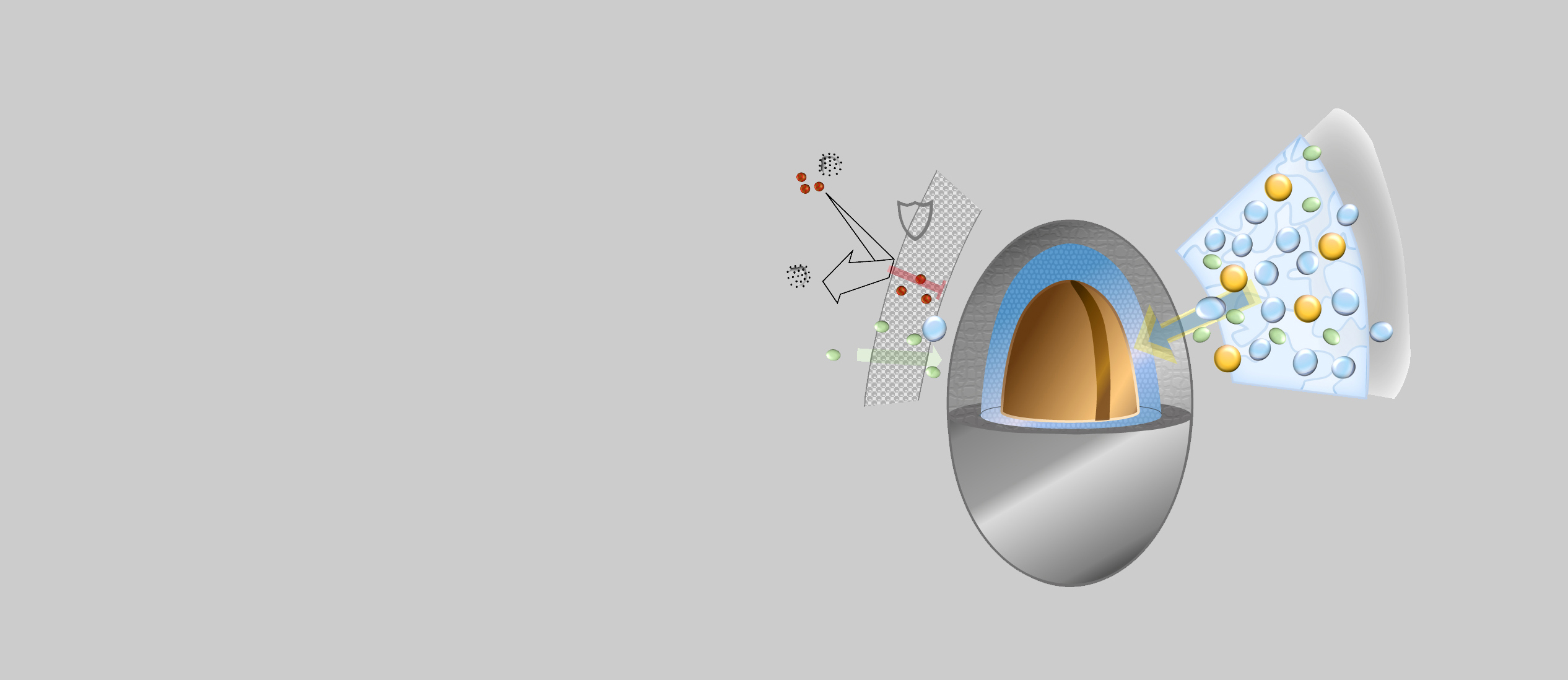Funktionale Evaluierung der Saatgutbeschichtung
In einer sehr anspruchsvollen Zeit des Klimawandels und der eingeschränkten Nutzung von Pflanzenschutzmitteln steigen die Ansprüche an die Landwirte in der ökologischen, aber vor allem auch in der konventionellen Landwirtschaft. Ein wichtiger Baustein in der Anpassung von Anbaumethoden ist die Unterstützung der ertragskritischen Frühentwicklung von Kulturpflanzen durch innovative Saatgutbeschichtung.



Um der Kulturpflanze gegenüber konkurrierenden Unkräutern einen Vorteil zu verschaffen, nehmen aktive Komponenten in neuen Saatgutformulierungen eine bedeutende Rolle ein. Neben strukturgebenden Komponenten, wie Binder oder Füllsubstanzen, werden in den Saatgutbeschichtungen Pestizide und Repellentien, Nährstoffe, sowie Keimungs- und Wachstumsstimulanzien, symbiontische Bodenmikroorganismen und Bodenverbesserer (Hydroabsorber) integriert. Dies führte zu einer Reduktion chemischer Pflanzenschutzmittel im Anbau. Trotzdem ist ein weiteres Umdenken gefordert: Die Alternative zu synthetischen Komponenten liegt vor allem in der Nutzung natürlicher Ausgangsstoffe. Ihre Integration in eine Beschichtung und ihre Wirksamkeit im Feld müssen jedoch erst kulturspezifisch etabliert und überprüft werden.
Bei der Entwicklung innovativer, multifunktionaler Saatgutbeschichtungen überprüfen wir in der Abteilung »Funktionelle und Angewandte Genomik« die Einflüsse einzelner Komponenten in unterschiedlichen Formulierungen auf das jeweilige Saatgut. In einem ersten Evaluierungsschritt zur Eignung der Ausgangsstoffe werden Material-, Prozess- und mechanische Verträglichkeit analysiert. Diese untersuchen wir zunächst anhand der Keimfähigkeit des behandelten Saatguts unter standardisierten Bedingungen. Wir erfassen die Keimung des Saatguts als die Summe der Ereignisse, die mit der Hydratation des Samens beginnen und mit der Ausbildung der Keimblätter enden.
Abbildungen 1 zeigt beispielhaft den Einfluss einer ausgewählten Beschichtungstechnologie auf die Keimfähigkeit des Russischen Löwenzahns (Taraxacum koksaghyz). Bei Beschichtung mit zwei unterschiedlichen Materialien erhöhte sich die relative Keimungsrate im Vergleich zu unbehandelten Samen um zwei (Material B) bzw. zwölf Prozent (Material A).
Der Einsatz einer alternativen Beschichtungstechnologie und Änderungen der Formulierungen (Abb. 2) führte für die Formulierungen C bis F zu einer signifikant gesteigerten Keimfähigkeit der beschichteten Samen um bis zu 58 Prozent im Vergleich zum unbehandelten Saatgut, während die Beschichtung mit Formulierung G die relative Keimungsrate drastisch um 61 Prozent reduzierte.
Basierend auf den Ergebnissen zur Keimfähigkeit entscheiden wir, welche der Formulierungen als Binde- oder Füllmittel oder als aktive Substanz für unsere multifunktionalen Beschichtungen geeignet sind und mit welchem technischen Prozess das Material auf das Saatgut optimal aufgebracht werden kann.
Im nächsten Schritt der Evaluierung untersuchen wir die Leistung der Kultur durch Variationen und Kombinationen der Beschichtungen im Vergleich zu unbehandeltem Saatgut. Die Leistung des Saatguts und der Kultur können über verschiedene Parameter im Gewächshaus und unter Freilandbedingungen untersucht werden. Zur funktionalen Evaluierung analysieren wir unter anderem das Absorptionsverhalten der Beschichtung bezüglich Herbizide und Wasser, die Frühentwicklung des Keimlings bei eingeschränkter Wasserversorgung, die Biomasseentwicklung nach Auflauf der Pflanzenkultur, sowie die Lagerfähigkeit des beschichteten Saatguts und dessen Kompatibilität mit gängigen Aussaattechniken. Kulturspezifische Anpassungen und Funktionserweiterungen erfolgen zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit unseren Partnern über Additive in der jeweiligen Formulierung oder durch Veränderungen im strukturellen Aufbau.
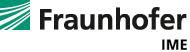 Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME
Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME