Hoffnung für die Landwirtschaft – Gießener Forschende entschlüsseln das Mikrobiom der Schilf-Glasflügelzikade
Die als neuer Agrarschädling auftretende Zikade beherbergt in verschiedenen Organen ein überraschend breites Spektrum an Mikroorganismen, die ihre schnelle Anpassung an neue Wirtspflanzen und die Übertragung von Krankheiten begünstigen.



Was ist die zentrale Botschaft Ihrer Studie – in einem Satz?
Wir haben festgestellt, dass die als neuer, bedeutender Schädling in der Landwirtschaft in Erscheinung getretene Schilf-Glasflügelzikade ein unerwartet breites Spektrum an Mikroorganismen in verschiedenen Organen beherbergt, welches neben den übertragenen pflanzenpathogenen Bakterien auch symbiontische Mikroben einschließt, die wahrscheinlich bei der raschen Anpassung an neue Wirtspflanzen eine Rolle spielen.
Welche zentralen Fragen haben Sie bei der Studie verfolgt – und welche früheren Forschungsergebnisse, Beobachtungen oder Forschungslücken haben Sie dazu inspiriert?
Im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen Verband der Hessisch-Pfälzischen Zuckerrübenanbauer e.V. (Rathenaustraße 10, 67547 Worms, Deutschland) und dem Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena wurde bei einem Monitoring von 2017 bis 2020 festgestellt, dass die auf der Roten Liste als gefährdet eingestufte Schilf-Glasflügelzikade (Pentastiridius leporinus), die als Überträger bakteriellen Vergilbungskrankheit bei der Zuckerrübe in Erscheinung getreten ist und sich in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern ausbreitet (Behrmann et al. 2021). Sie überträgt neben dem γ-Proteobakterium Candidatus Arsenophonus phytopathogenicus (CAP) auch das Stolbur-Phytoplasma Candidatus Phytoplasma solani (CPS), die den Krankheitskomplexe »Syndrome des basses richesses« (Syndrom der niedrigen Zuckergehalte, SBR) und Stolbur verursachen. Dies führt zur Absenkung des Zuckergehalts und zu »Gummirüben«. Dies geht mit einer Beeinträchtigung der Lager- und Verarbeitungsfähigkeit einher. Vor diesem Hintergrund haben wir eine Laborzucht der Schilf-Glasflügelzikade aufgebaut und ihre Biologie erforscht (Behrmann et al. 2022). Zudem haben wir festgestellt, dass dieses Schadinsekt auch die Kartoffel als Wirtspflanze nutzen und auf diese ihre bakteriellen Krankheitserreger übertragen kann (Behrmann et al. 2023, Rinklef et al. 2024). Im Rahmen eines weiteren Forschungsvorhabens entwickeln wir PCR-gestützte Methoden für das Monitoring der Ausbreitung dieser Pflanzenpathogene. Die schnelle Erweiterung des Wirtspflanzenspektrums inspirierte uns dazu, die möglichen Ursachen zu erforschen.
Warum ist die Schilf-Glasflügelzikade Pentastiridius leporinus ein besonders spannendes Forschungsobjekt?
Die heimische Schilf-Glasflügelzikade hat sich in relativ kurzer Zeit von einer bedrohten Art zu einem Schädling entwickelt, der sich rasant ausbreitet und auf immer mehr Nutzpflanzen (Zuckerrübe, Winterweizen, Kartoffel, Zwiebel, Karotte usw.) Krankheitserreger überträgt und so einen wachsenden ökonomischen Schaden für die Landwirtschaft verursacht. Wie sich dieser Schädling an die unterschiedlichen Abwehrmechanismen der Wirtspflanzen anpassen kann, ist unbekannt. Deshalb lassen sich an diesem Insekt besonders gut Mechanismen studieren, die in der Evolution eine Erweiterung der ökologischen Nische ermöglichen. Ferner eignet sich dieser Schädling als Modell für die Entwicklung innovativer und umweltfreundlicher Bekämpfungsoptionen.
Kurz und klar: Was sind die wichtigsten Ergebnisse eurer Studie – in wenigen einfachen Sätzen?
Neben den bekannten Pflanzenpathogenen Bakterien Candidatus Arsenophonus phytopathogenicus und Candidatus Phytoplasma solani haben wir in verschiedenen Organen der Schilf-Glasflügelzikade fünf weitere Bakterienarten identifiziert (die zu den Gattungen Purcelliella, Karelsulcia, Vidania, Rickettsia und Wolbachia gehören), welche wahrscheinlich als Symbionten die Ernährung von Pflanzensäften ermöglichen. Sowohl von den Pflanzenpathogenen als auch von allen Symbionten wurden die Genome sequenziert und ihre Verteilung im Körper lokalisiert.
Gab es Ergebnisse, die Sie wirklich überrascht haben – etwa eine unerwartete Bakterienart, eine ungewöhnliche Lokalisierung oder eine überraschende Vielfalt an Mikroben?
Uns hat erstaunt, dass die Wolbachia-Bakterien in den Zellen und die Rickettsien sogar im Zellkern von Geweben in der Zikade vorkommen.
Wie könnte die Fähigkeit der Zikade, von Schilfgras auf Zuckerrüben und Kartoffeln zu wechseln, mit ihrer Mikrobenflora zusammenhängen?
Viele Insekten, die sich ausschließlich von Pflanzensäften ernähren, wie Blattläuse und Zikaden, beherbergen in ihrem Körper symbiontische Mikroorganismen, welche lebenswichtige Stoffe wie Vitamine bereitstellen. In den Genomen der Mikrobenflora haben wir genetische Signaturen gefunden, die andeuten, dass diese zehn essentiellen Aminosäuren und B-Vitamine herstellen können. In den Genomen der Pflanzenpathogene haben wir verschiedene Virulenzfaktoren gefunden, welche zur Entstehung der Krankheitsbilder von befallenen Pflanzen beitragen können. Die übertragenen Pflanzenpathogene verursachen mit den sichtbaren Krankheitsbildern einhergehend eine Schwächung der Kulturpflanzen gegen Vektorinsekten.
Was bedeutet es, dass CAP in vielen Geweben vorkommt, während CPS nur in den Speicheldrüsen sitzt – und wie könnte das die Übertragung von Pflanzenkrankheiten beeinflussen?
Nur die Mikroben, die in der Speicheldrüse vorkommen, können mit dem Speichel auf die jeweilige Wirtspflanze und von dort über deren Pflanzensaft auf andere Individuen (horizontal) übertragen werden. CAP dagegen kann darüber hinaus auch mit den Eiern auf die nächste Generation (vertikal) übertragen werden. Bei den obligaten Symbionten ist von einer ausschließlich vertikalen Übertragung auf die nächste Generation auszugehen.
Warum ist es bemerkenswert, dass die Zikade sieben verschiedene Bakterienarten beherbergt – darunter obligate Symbionten, fakultative Symbionten und sogar Krankheitserreger – und wie könnte diese Vielfalt ihre Anpassungsfähigkeit erklären?
Obligat symbiotische Bakterien passen sich über längere Zeiträume so an ihren Insektenwirt an, dass sie ohne diesen nicht mehr existieren können. Dabei verkleinern sich Verlauf der Koevolution ihre Genome, da Gene, die für das Überleben außerhalb des Wirts nicht mehr gebraucht werden, verloren gehen. Fakultative Symbionten haben sich nicht so stark an ihren Wirt angepasst und sind auch ohne den Wirt lebensfähig. Die übertragenen Bakterien CAP und CPS können sich sowohl in den Wirtspflanzen als auch in den Insekten vermehren. Während sie in den Wirtspflanzen Krankheiten verursachen und damit einhergehend deren Abwehrkräfte gegen Pflanzensaftsaugende Insekten schwächen, profitieren sie auf diese Weise den übertragenen Wirtsinsekten. Wir gehen davon aus, dass alle identifizierten Bakterienarten die Fitness der Schilf-Glasflügelzikade erhöhen.
Wie könnte die Tatsache, dass die Zikade durch ihre Mikroben ihre Ernährung ausgleicht, erklären, warum sie nun auf so viele Pflanzen übergehen kann – und was bedeutet das für die Zukunft von Schädlingsausbrüchen?
Pflanzensaftsaugende Insekten leben von einer Mangeldiät, die viel Zucker, aber wenig Eiweiß enthält, weshalb auch die Herstellung von Vitaminen und anderen lebensnotwendigen Stoffen eingeschränkt ist. Die von den Mikroben hergestellten Nahrungsergänzungsmittel fördern die Fitness und das Reproduktionspotenzial der Zikaden. Das expandierende Anpassungspotenzial von Schilf-Glasflügelzikaden und anderen Schadinsekten bedroht die Landwirtschaft und stellt die Landwirte vor wachsenden Herausforderungen.
In Zeiten des Klimawandels entstehen immer mehr »neue Schädlinge«. Kann eure Studie helfen, solche Entwicklungen besser zu verstehen und vorherzusagen?
Vorangegangene Studien (Behrmann et al. 2021) an Zuckerrüben in Hessen, Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben gezeigt, dass die Ausbreitung des SBR mit der Ausbreitung der Schilf-Glasflügelzikade einhergeht und wahrscheinlich durch den Klimawandel gefördert wird. Wir gehen davon aus, dass künftig weitere heimische Insektenarten als Schädlinge in Erscheinung treten werden, wenn sie sich im Zuge des Klimawandels ausbreiten.
Welche konkreten Ansätze für einen nachhaltigen Pflanzenschutz könnten sich aus euren Erkenntnissen ergeben?
Da die Pflanzenpathogene auch von anderen Insektenarten übertragen werden können, wird gegenwärtig erforscht, ob gegen die Krankheitserreger resistente bzw. tolerante Nutzpflanzen gezüchtet werden können. Ein weiterer Ansatz ist die Entwicklung von neuen Methoden, mit denen gezielt die Pflanzenpathogene oder die essentiellen Symbionten der Vektorinsekten ausgeschaltet werden können. Dabei hoffen wir, dass die Abhängigkeit der Zikaden von ihren Symbionten als Schwachstelle für die Entwicklung einer innovativen Bekämpfungsoption genutzt werden kann.
Welche weiteren Fragen planen Sie nun zu untersuchen – und welche neuen Methoden oder Technologien werden Sie dafür einsetzen?
Zunächst untersuchen wir, ob die Zikaden mit ihrem Speichel Substanzen in die Wirtspflanze injizieren können, welche deren Abwehrkräfte schwächen. Dabei werden neben Transkriptom- und Proteom-Analysen auch chemische Analysen durchgeführt. Zudem wird untersucht, ob sich der Zikadenspeichel unterscheidet, wenn sie verschiedene Wirtspflanzen befallen. Um die Funktion einzelner Speichelproteine zu erforschen, soll deren Produktion in der Speicheldrüse mit Hilfe der RNA-Interferenz gehemmt werden. Hierfür werden sogenannte doppelsträngige RNAs (dsRNAs) gegen das Zielgen injiziert. Gegenwärtig entwickeln wir auf dsRNAs basierende Sprays für die gezielte und umweltfreundliche Bekämpfung von Schilf-Glasflügelzikaden und anderen Schädlingen.
Publikationen:
Behrmann S, Schwind M, Schieler M, Vilcinskas A, Martinez O, Lee KZ, Lang C. (2021).
Spread of bacterial and virus yellowing diseases of sugar beet in South and Central Germany from 2017–2020.
Sugar Industry 46, 476–485; https://doiorg/ 10.36961/si27343
Behrmann S, Witczak N, Lang C, Schieler M, Dettweiler A, Kleinhenz B, Schwind M, Vilcinskas A, Lee KZ. (2022).
Biology and rearing of the planthopper Pentastiridius leporinus, an emerging pest in sugar beets.
Insects 13, 656; doi.org/10.3390/insects13070656
Behrmann S, Rinklef A, Lang C, Vilcinskas A, Lee KZ. (2023).
Potato (Solanum tuberosum) as a new host for Pentastiridius leporinus (Hemiptera: Cixiidae) and Candidatus Arsenophonus phytopathogenicus.
Insects 14, 281; doi: 10.3390/insects1403028.
Rinklef A, Behrmann S, Löffler D, Erner J, Meyer MV, Lang C, Vilcinskas A, Lee, K.-Z. (2024).
Prevalence in potato of ‘Candidatus Arsenophonus Phytopathogenicus’ and ‘Candidatus Phytoplasma Solani’ and their transmission via adult Pentastiridius leporinus.
Insects 15 (4): 275; doi: 10.3390/insects15040275.
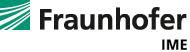 Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME
Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME