Motivation und Problemstellung
Die Landwirtschaft steht vor einem tiefgreifenden Wandel, in dem wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche Interessen unter dem Einfluss von Klimawandel und geopolitischen Krisen ausbalanciert werden müssen. Regulatorische Vorgaben, wie die EU-Ziele zur Halbierung des Einsatzes chemischer Pflanzenschutzmittel (PSM) bis 2030, stellen Landwirte vor große Herausforderungen, da alternative Strategien zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten noch nicht ausgereift sind. Ein übermäßiger Einsatz von Fungiziden führt zu Biodiversitätsverlusten, während ihr Verzicht erhebliche Ertragseinbußen nach sich ziehen kann. Das mittelfristige Ziel muss daher sein, die Menge an PSM optimal an den tatsächlichen Bedarf anzupassen und nur dann PSM auszubringen, wenn tatsächlich ein pathogener Befall vorhanden ist oder droht. Hierfür müssen neue innovative Verfahren entwickelt werden, um einen solchen Befall möglichst frühzeitig zu erkennen oder anhand intelligenter Prognosemodelle vorhersagen zu können.
Derzeit erfolgt die Erkennung von Pflanzenpathogenen entweder durch visuelle Inspektion oder zeitaufwendige Laboranalysen. Während molekularbiologische Methoden wie PCR oder ELISA eine hohe Sensitivität bieten, sind sie für den praktischen Feldeinsatz nicht geeignet. Schnelltests wie Lateral Flow Assays (LFA) sind zwar vor Ort anwendbar, aber oft nicht sensitiv genug, um frühzeitig Infektionen zu detektieren.
Das Verbundprojekt »MagnI-SENSE« zielt darauf ab, ein innovatives Analyse- und Monitoringsystem zu entwickeln, das eine integrierte vor-Ort-Analytik, ein individuelles Beratungskonzept und eine KI-gestützte Prognose für Befallserkennung umfasst. So sollen Landwirte in die Lage versetzt werden den PSM Einsatz insgesamt deutlich zu reduzieren, dabei die Ernteerträge zu maximieren und so neben dem positiven ökologischen Aspekt auch erhebliche Kosten einzusparen.
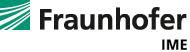 Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME
Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME

