Motivation und Problemstellung
Rekombinante, komplexe Proteine gewinnen in der Medizin, sowohl für die Diagnostik als auch die Therapie eine immer größere Bedeutung. Aufgrund ihrer post-translationalen Modifikationen können vieler dieser Proteine allerdings nur in eukaryotischen Produktionssystemen wie Säugerzellen hergestellt werden, die aufgrund der komplexen Medien extrem teuer und wenig nachhaltig sind und daher nur für die Großproduktion von Proteinen mit hohen Gewinnmargen eingesetzt werden. Pflanzenzellen können dagegen in einfachen und gut verfügbaren Medien kultiviert werden und stellen eine kostengünstige und nachhaltige Alternative dar, die auch für die Herstellung von komplexen Proteinen mit geringerer Gewinnmarge geeignet sind. Nichtsdestotrotz finden Pflanzenzellen zurzeit nur für bestimmte Nischenprodukte Anwendung, da die Produktivität von Pflanzenzellen mit 100 mg – 1 g/L unter denen von Säugerzellen mit 1 – 5 g/L liegt. Die hohen Ausbeuten bei Säugerzellen werden dabei u. a. durch die systematische Optimierung der Medien unter Berücksichtigung des Stoffwechsels der Zellen erreicht, wobei miniaturisierte Kultivierungssysteme im Mikrotiterplattenformat eingesetzt werden, die eine Testung unterschiedlichster Bedingungen im Hochdurchsatz ermöglichen. Solche miniaturisierten Kultivierungssysteme und solche Stoffwechselmodelle gibt es bis jetzt noch nicht für Pflanzenzellen und die verwendeten Kultivierungsbedingungen beruhen v. a. auf Erfahrungswerten und nicht auf einer systematischen Untersuchung und Anpassung. Die Gestaltung der Kultivierungsbedingungen ist allerdings ein dynamischer Prozess, d. h., das Auffinden von optimalen Trajektorien für die Einflussgrößen eröffnet zu viele Freiheitsgrade, als dass diese allein durch Erfahrung bestmöglich gestaltet werden könnten.
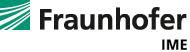 Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME
Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME