Motivation und Problemstellung
Krankheiten wie Krebs, Diabetes oder bestimmte Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden durch eine Kombination von genetischen, umwelt- und verhaltensbedingten Faktoren verursacht. In der Regel spielen körpereigene Proteine eine wichtige Rolle bei der Entstehung und der klinischen Ausprägung dieser Krankheiten und sind daher potenzielle Ziele für die medikamentöse Behandlung. Viele herkömmliche Wirkstoffe fungieren als Inhibitoren, die an die Zielproteine binden und katalytische Aktivitäten oder molekulare Interaktionen behindern. Eine relativ neue Strategie ist der Abbau von Zielproteinen durch das zelleigene Ubiquitin-Proteasom-System (UPS). Dazu muss der E3-Ligase-Komplex, welcher im Rahmen des regulären Zellstoffwechsels für die spezifische Markierung von Proteinen mit Ubiquitin zuständig ist, zur Modifikation von Proteinen „gezwungen“ werden, die er normalerweise nicht als Substrat erkennt. Dies lässt sich entweder mit bifunktionalen Molekülen (PROteolysis Targeting Chimeras, PROTACs) oder mit molekularen Klebstoffen erreichen. PROTACs enthalten einen Liganden für die E3-Ligase, der über einen Linker mit einem Liganden für das Zielprotein verbunden ist. Im Gegensatz dazu induzieren molekulare Klebstoffe Konformationsänderungen der E3-Ligase oder des Zielproteins, so dass es zur ternären Komplexbildung und Ubiquitinierung des Zielproteins und schließlich zu seinem Abbau kommt. Auf diese Weise können Krankheits-assoziierte Proteine adressiert werden, für die bislang keine Wirkstoffe entwickelt werden konnten. Bei der anspruchsvollen Entwicklung solcher Moleküle gibt es derzeit jedoch einen Engpass beim Screening. Während, auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI), immer größere Kandidatenbibliotheken abgeleitet werden können, gibt es auf der Seite von schnellen, flexiblen und kostengünstigen Screening-Systemen erheblichen Nachholbedarf.
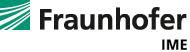 Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME
Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME